Inhalt des Artikels
- Energieaudit: Die Grundlage für mehr Energieeffizienz im Unternehmen
- Ist ein Energieberater bei energetischen Sanierungen Pflicht?
- Energieberatung für Nichtwohngebäude: Unterschiede zu Wohngebäuden
- Was kostet eine Energieberatung für Nichtwohngebäude?
- Förderung der Energieberatung
- Förderprogramme für energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden
- Wie und wo finde ich zertifizierte Energieberater:innen?
- Welche Anlagen und Systeme eigenen sich für Nichtwohngebäude?
- Fazit
- Häufig gestellte Fragen
Inhalt
Das Wichtigste in Kürze
- Eine professionelle Energieberatung hilft, Einsparpotenziale in Nichtwohngebäuden systematisch zu identifizieren und wirtschaftlich umzusetzen.
- Die Bundesförderung übernimmt bis zu 50%, bei Kommunen und gemeinnützigen Trägern sogar bis zu 90% des Beratungshonorars.
- Förderfähige Beratungen müssen durch zertifizierte Energieberater:innen erfolgen, z.B. nach DIN EN 16247 oder DIN V 18599.
- Die Beratung bildet die Grundlage für weitere Förderprogramme zur Umsetzung – etwa über die BEG oder KfW.
Energieaudit: Die Grundlage für mehr Energieeffizienz im Unternehmen
Energie ist für viele Unternehmen längst nicht mehr nur ein Kostenfaktor, sondern ein strategischer Hebel für Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Steigende Energiekosten, gesetzliche Anforderungen und der Wunsch nach klimafreundlicherem Wirtschaften machen professionelle Energieberatungen für Nichtwohngebäude zunehmend relevant.
Eine Energieberatung und die anschließende energetische Sanierung bietet doppelten Anreiz, da neben der generellen Optimierung der Energiekosten auch Förderprogramme zur Verfügung stehen, um das Vorhaben zu stützen.
- Energiekosten senken: Verbrauch analysieren, Einsparpotenziale identifizieren, wirtschaftlich optimieren
- Fördermittel nutzen: Bis zu 50%, in Einzelfällen bis zu 90% Zuschuss möglich
- Rechtssicherheit schaffen: Normkonforme Beratung nach DIN EN 16247 oder DIN V 18599 Nachhaltigkeit fördern: Beitrag zu Klimazielen und CSR-Strategien
- Investitionen vorbereiten: Grundlage für Maßnahmen wie PV-Anlagen oder Wärmepumpen
- Vermeiden teurer Fehler: Energieberater:innen bringen Erfahrung und Know-how ein, was langfristig Kosten sparen kann

Ist ein Energieberater bei energetischen Sanierungen Pflicht?
Eine generelle Pflicht zur Beauftragung eines Energieberaters besteht bei energetischen Sanierungen von Nichtwohngebäuden nicht in jedem Fall, jedoch ist sie in vielen Situationen sinnvoll oder sogar Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Fördermitteln. Wer etwa eine Förderung im Rahmen der Bundesförderung für Energieberatung (BAFA) oder anderer Programme beantragen möchte, muss eine qualifizierte Energieberatung nachweisen, meist nach DIN EN 16247 oder DIN V 18599.
Auch im Rahmen von Energieaudits, die für bestimmte Unternehmen gemäß EBN (Energiedienstleistungsgesetz) verpflichtend sind, ist ein:e zertifizierte:r Energieberater:in notwendig.
Insbesondere bei komplexen Systemen und hohen Investitionssummen dient die Einbindung eines Energieberaters nicht nur der Qualitätssicherung, sondern ist oft entscheidend, um Einsparpotenziale vollständig zu erkennen und spätere Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Sie möchten passende Energieberater:innen schnell und unkompliziert finden?
Unser Tool unterstützt Sie dabei, gezielt zertifizierte Expert:innen auszuwählen - zeitsparend, zuverlässig und förderkonform.
Energieberatung für Nichtwohngebäude: Unterschiede zu Wohngebäuden
Die energetische Bewertung von Nichtwohngebäuden unterscheidet sich in mehreren Punkten deutlich von der Beratung für Wohngebäude, sowohl in der Methodik als auch im rechtlichen und technischen Rahmen. Während bei Wohngebäuden primär der Energieverbrauch im häuslichen Alltag betrachtet wird, sind Nichtwohngebäude oft komplexer: Sie verfügen über unterschiedliche Nutzungszonen, aufwendige Anlagen- und Lüftungssysteme sowie stark schwankende Betriebszeiten. Das erfordert eine detailliertere Analyse, häufig auf Basis der DIN V 18599 oder DIN EN 16247.
Zu den Nichtwohngebäuden zählen:
- Büro- und Produktionsgebäude
- Schulen, Kindergärten und Hochschulen
- Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen
- Verwaltungsgebäude und Rathäuser
- Sporthallen, Veranstaltungsräume und Kulturzentren
- Lagerhallen, Werkstätten und Verkaufsflächen
- Gebäude von gemeinnützigen Organisationen und Kirchen
Für viele dieser Gebäudearten ist eine systematische Energieberatung nicht nur sinnvoll, sondern Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln. In Förderprogrammen wie der Bundesförderung für Energieberatung (BAFA) werden Nichtwohngebäude daher häufig in eigenen Modulen (z.B. Modul 1 oder Modul 2) behandelt, mit speziell angepassten Anforderungen und Fördersätzen.

Was kostet eine Energieberatung für Nichtwohngebäude?
Die Kosten für eine Energieberatung bei Nichtwohngebäuden variieren je nach Größe, Nutzung und Komplexität des Gebäudes sowie dem Umfang der Analyse. In der Praxis bewegen sich die Honorare oft im Bereich von 2.000€ bis 10.000€, bei sehr großen oder technisch aufwendigen Objekten auch darüber. Entscheidend ist: Ein großer Teil dieser Kosten ist förderfähig.
Über die Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (kurz: EBN) übernimmt der Staat in der Regel 50% des förderfähigen Beratungshonorars, bei Kommunen, kommunalen Zweckverbänden oder gemeinnützigen Organisationen können es sogar bis zu 90% sein. Die genaue Höhe hängt vom jeweiligen Modul (z.B. Modul 1 oder Modul 2), dem Beratungsumfang und der Antragstellergruppe ab. Wichtig ist: Die Förderung muss vor Beginn der Beratung beantragt werden.
Förderung der Energieberatung
Die finanzielle Unterstützung für eine Energieberatung richtet sich nach dem gewählten Fördermodul. Die Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Beratungsarten, jeweils mit klar definierten Förderhöhen:
Energieaudit nach DIN EN 16247
Unternehmen mit jährlichen Energiekosten über 10.000€ erhalten einen Zuschuss von bis zu 50% des Beratungshonorars, maximal jedoch 3.000€. Liegen die Energiekosten unterhalb dieser Schwelle, beträgt der Zuschuss ebenfalls 50%, jedoch gedeckelt auf 600€.
Energieberatung nach DIN V 18599 für Nichtwohngebäude
Auch hier werden 50% der förderfähigen Ausgaben übernommen mit einem Förderhöchstbetrag von 4.000€. Die konkrete Fördersumme orientiert sich an der Nettogrundfläche des jeweiligen Gebäudes.
Contracting-Orientierungsberatung
Bei Energiekosten bis 300.000€ jährlich liegt der maximale Zuschuss bei 3.500€. Übersteigt der Energieverbrauch diesen Wert, sind bis zu 5.000€ Förderung möglich, jeweils bei einer Förderquote von 50%.
Unabhängig vom gewählten Modul gilt: Die Beratung muss durch eine:n qualifizierte:n Energieberater:in erfolgen. Unternehmen haben dabei freie Wahl unter allen zugelassenen Fachleuten – vorausgesetzt, die Anforderungen an Qualifikation und Erfahrung werden erfüllt.
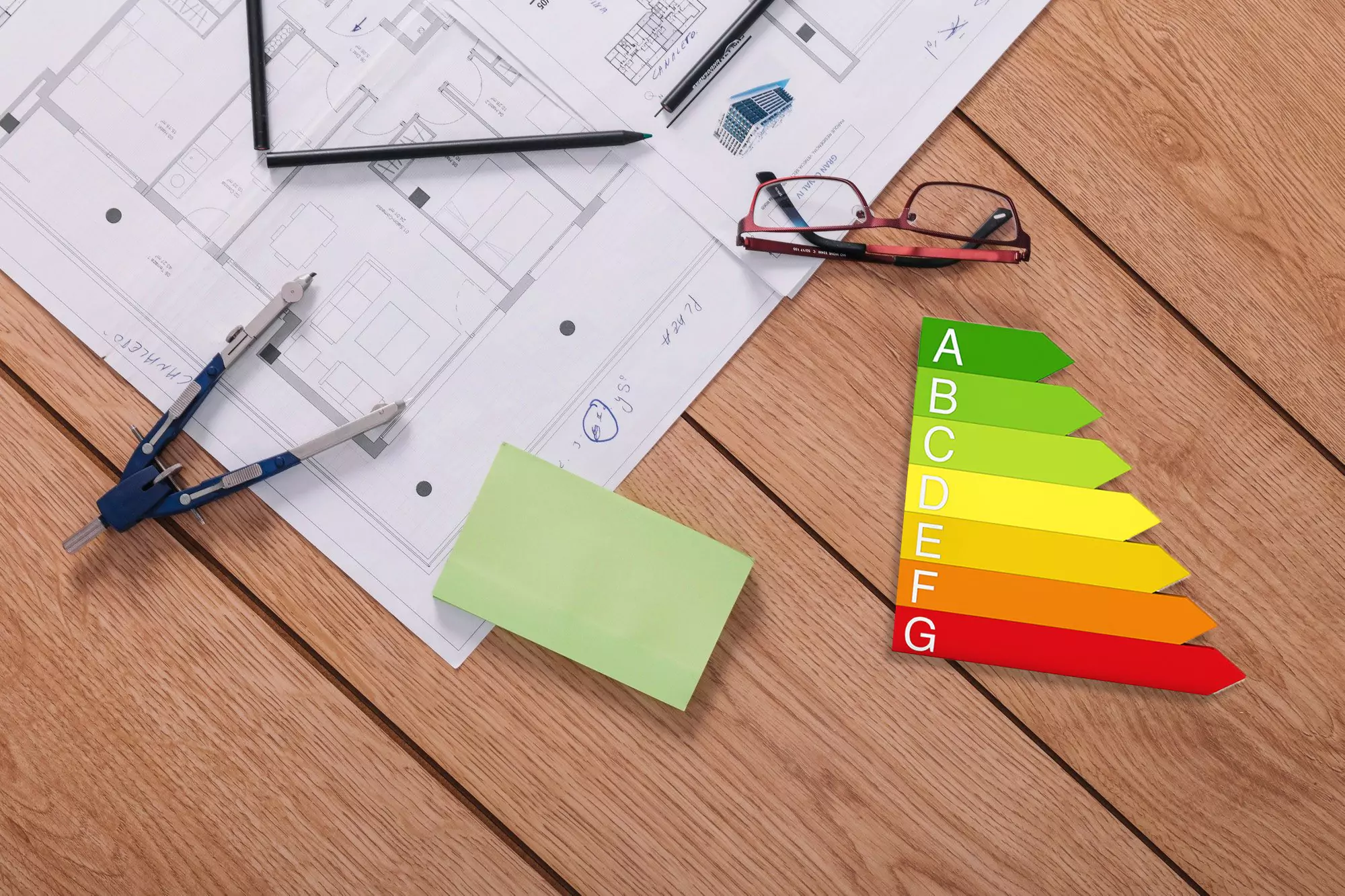
Förderprogramme für energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden
Die Energieberatung ist oft nur der erste Schritt. Im Anschluss daran profitieren Unternehmen auch bei der Umsetzung empfohlener Maßnahmen von attraktiven Förderprogrammen. Die Ergebnisse der Beratung dienen dabei als Grundlage für weitere Anträge. Besonders relevant sind folgende Programme:
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Über die BEG können energetische Sanierungen von Nichtwohngebäuden finanziell unterstützt werden, z.B. Dämmmaßnahmen, Fenstertausch, Erneuerung der Anlagentechnik oder Einbindung erneuerbarer Energien. Die Förderhöhe beträgt bis zu 30%, in bestimmten Fällen sind bis zu 50% der förderfähigen Investitionskosten möglich.
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)
Relevant für Unternehmen, die sich an Nah- oder Fernwärmenetze anschließen oder selbst Wärmenetze betreiben. Auch hier sind hohe Zuschüsse möglich, u.a. für den Einsatz regenerativer Energiequellen.
KfW-Förderprogramme
Die KfW bietet zinsgünstige Kredite und Tilgungszuschüsse für energieeffiziente Maßnahmen, z.B. Gebäudesanierungen, Heizungsmodernisierung oder Digitalisierung von Energiesystemen. Die Förderkonditionen orientieren sich an der erreichten Effizienzstufe oder CO₂-Einsparung.
BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Einzelmaßnahmen wie der Austausch alter Heiztechnik durch Wärmepumpen, Biomasseanlagen oder Solarthermie können mit bis zu 40% gefördert werden. Auch Optimierungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen sind förderfähig.
Voraussetzung für viele dieser Programme ist ein zuvor erstellter, förderkonformer Energieberatungsbericht. Unternehmen, die frühzeitig in eine qualifizierte Energieberatung investieren, schaffen damit die Basis für eine solide und finanziell unterstützte Umsetzung ihrer Effizienzmaßnahmen.
Wie und wo finde ich zertifizierte Energieberater:innen?
Für eine förderfähige Energieberatung ist es entscheidend, auf zertifizierte Energieberater:innen zurückzugreifen, die die Anforderungen der entsprechenden DIN-Normen erfüllen. Qualifizierte Fachleute finden Sie über die offizielle Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes (www.energie-effizienz-experten.de). Dort können Sie gezielt nach Berater:innen in Ihrer Region suchen, gefiltert nach Gebäudetyp, Beratungsart und Zulassung für bestimmte Förderprogramme. Wichtig: Nur Beratungen durch gelistete Expert:innen sind förderfähig – frühzeitige Prüfung spart Zeit und sichert finanzielle Vorteile.
Sie möchten passende Energieberater:innen schnell und unkompliziert finden?
Unser Tool unterstützt Sie dabei, gezielt zertifizierte Expert:innen auszuwählen - zeitsparend, zuverlässig und förderkonform.
Welche Anlagen und Systeme eigenen sich für Nichtwohngebäude?
Nichtwohngebäude weisen häufig ein hohes, bislang ungenutztes Einsparpotenzial auf, insbesondere in Bereichen mit dauerhaftem Energiebedarf. Eine Energieberatung hilft dabei, diese Potenziale gezielt zu identifizieren und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. Besonders häufig betreffen Optimierungen folgende Bereiche:
- Wärmeversorgung: z.B. veraltete Heizkessel, fehlende hydraulische Abgleiche, Potenzial für den Einsatz von Wärmepumpen oder Biomasseanlagen
- Lüftungs- und Klimatechnik: ineffiziente Lüftungsanlagen, ungeregelte Zu- und Abluftsysteme, überdimensionierte Klimageräte
- Beleuchtung: veraltete Leuchtstoffröhren, keine tageslichtabhängige Steuerung, Potenzial für Umrüstung auf LED-Technik
- Gebäudeautomation und Regeltechnik: fehlende oder veraltete Steuerungssysteme, ungenutzte Zeitprogramme
- Druckluft- und Kühlanlagen: Leckagen, ineffiziente Verdichter oder ungeregelte Systeme
Durch die Kombination aus technischer Analyse und wirtschaftlicher Bewertung lassen sich gezielt Maßnahmen entwickeln, die sowohl Energie sparen als auch Investitionssicherheit bieten. Energieberater:innen unterstützen Sie beim Aufdecken von Potentialen für mehr Energieeffizienz und die Einhaltung relevanter Richtlinien.
Fazit
Energieberatungen für Nichtwohngebäude bieten Unternehmen, Kommunen und Organisationen eine fundierte Grundlage, um Energiekosten zu senken, Effizienzpotenziale zu nutzen und gezielt Fördermittel zu beantragen. Wer frühzeitig auf qualifizierte Beratung setzt, sichert sich finanzielle Vorteile und schafft die Basis für nachhaltige Investitionen in die Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gegenstand der Förderung für Nichtwohngebäude?
Gefördert wird die Energieberatung für Nichtwohngebäude, insbesondere zur energetischen Bewertung von Bestandsgebäuden, beim Neubau sowie zur Vorbereitung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die förderfähigen Ausgaben umfassen in der Regel das Beratungshonorar für eine geförderte Energieberatung gemäß DIN V 18599 oder DIN EN 16247.
Neben der Förderung einer Energieberatung sind auch die anschließenden Maßnahmen zur energetischen Sanierung förderbar.
Wie hoch ist der Zuschuss für eine Energieberatung für Unternehmen?
Die Förderhöhe beträgt 50% des Beratungshonorars, unabhängig davon, ob es sich um ein Energieaudit für Konzerne oder eine Energieberatung im Mittelstand handelt. In bestimmten Fällen, etwa bei kommunalen Gebietskörperschaften oder gemeinnützigen Trägern, können die Fördermittel 90% der förderfähigen Ausgaben betragen. Jedoch sind die möglichen Zuschüsse begrenzt auf eine Maximalsumme.
Was ist die DIN V 18599?
Die DIN V 18599 ist ein technisches Regelwerk zur energetischen Bewertung von Nichtwohngebäuden, sowohl im Bestand als auch beim Neubau. Sie bildet die Grundlage für die Förderung einer Energieberatung, insbesondere im Rahmen der Bundesförderung für Energieberatung (Modul 2).
Was ist die DIN EN 16247?
Die DIN EN 16247 beschreibt die Anforderungen an ein Energieaudit im Sinne des Energiedienstleistungsgesetzes. Sie kommt vor allem bei Unternehmen zum Einsatz und ist Voraussetzung für die Förderung, wie sie im Modul 1 umgesetzt werden.
Was bedeutet Modul 1 und Modul 2?
Modul 1 fördert die Durchführung eines Energieaudits gemäß DIN EN 16247, insbesondere für Unternehmen mit hohem Energieverbrauch. Modul 2 hingegen richtet sich an Beratungen nach DIN V 18599, etwa für kommunale Gebietskörperschaften, Kommunen oder Länder und bei der Neubauberatung für Nichtwohngebäude.
Beide Module lösen einen Finanzierungsanteil aus Mitteln des Förderprogramms und dritter Stellen aus. Die Förderung erfolgt auf Basis der aktuell gültigen Richtlinien.




