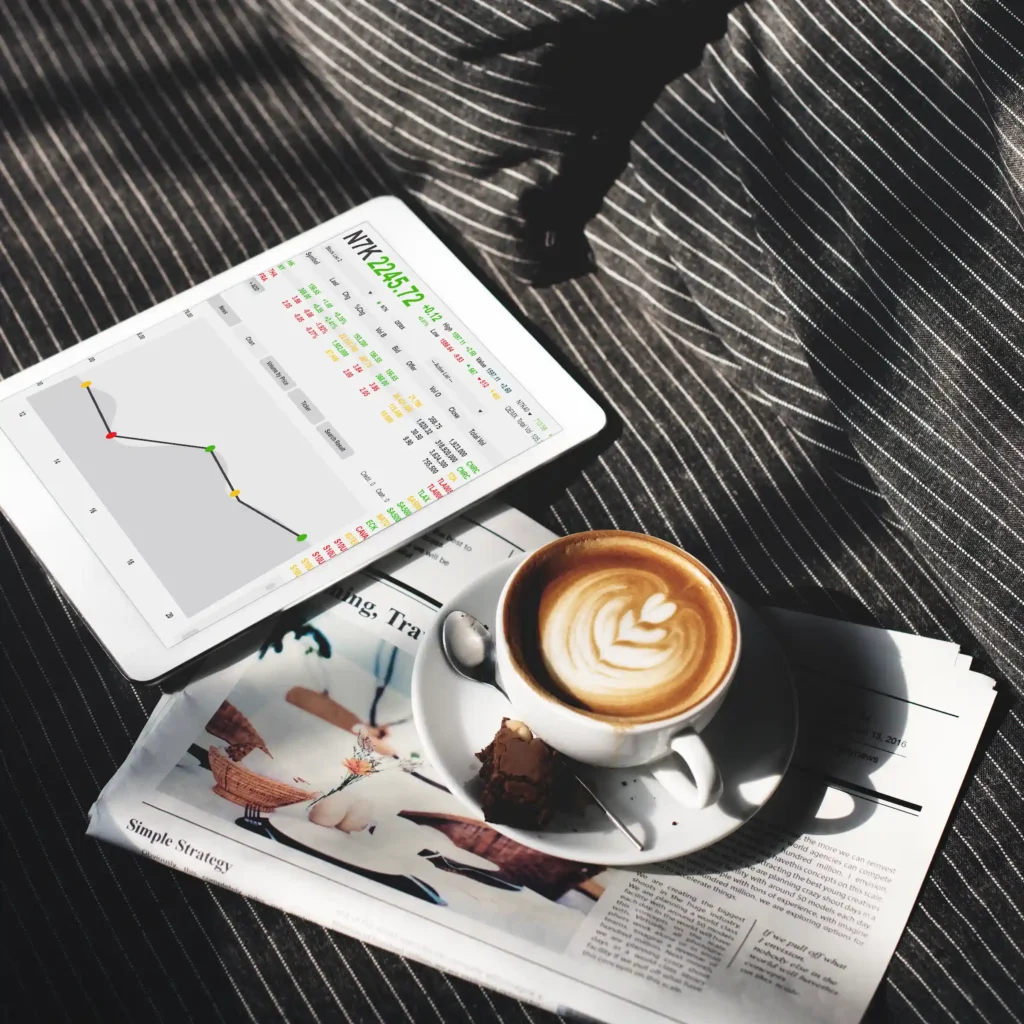Die DIN ISO 26000 dient als international anerkannter Leitfaden für gesellschaftliche Verantwortung, bietet einen umfassenden Orientierungsrahmen und beschreibt, wie Organisationen ihrer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt gerecht werden können. Sie beeinflusst damit auch ESG-Kriterien und kann sich positiv auf den Markt nachhaltiger Investments auswirken.
Das Wichtigste in Kürze
- Internationaler Leitfaden: Die ISO 26000 ist seit 2010 ein freiwilliger Standard für gesellschaftliche Verantwortung aller Organisationstypen
- Sieben Kernthemen: Von Menschenrechten über Umweltschutz bis hin zu fairen Geschäftspraktiken werden alle ESG-relevanten Bereiche abgedeckt
- Kein Zertifizierungsstandard: Anders als andere ISO-Normen dient sie ausschließlich als Orientierungshilfe und Leitfaden
- Relevanz für Investor:innen: Unternehmen, die sich an der ISO 26000 orientieren, bieten oft bessere ESG-Performance und transparentere Nachhaltigkeitsberichterstattung
Warum ist die ISO 26000 wichtig?
Die ISO 26000 stellt einen globalen Konsens über gesellschaftliche Verantwortung dar. Sie bietet Unternehmen aller Größenordnungen einen strukturierten Ansatz, um ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt systematisch zu bewerten und zu verbessern. Als „unbesungener Held“ der ESG-Standards bildet sie eine solide Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften. Alle Themen, die sich in den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) und im EU Green Deal wiederfinden, sind bereits in der ISO 26000 enthalten.
Ihr Shortcut zum ersten nachhaltigen Investment
Sie wollen direkt loslegen? Unser Guide leitet Sie Schritt-für-Schritt bis zum ersten nachhaltigen Investment. Praxisnah. Einfach erklärt und zu 100% auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.
Definition: Was ist die ISO 26000?
Die ISO 26000 ist ein internationaler Standard für gesellschaftliche Verantwortung, der im November 2010 von der International Organization for Standardization entwickelt wurde. Anders als andere ISO-Standards handelt es sich nicht um eine zertifizierbare Norm, sondern um einen Leitfaden, der Organisationen dabei unterstützt, ihre gesellschaftliche Verantwortung zu verstehen, zu optimieren und über Nachhaltigkeitsberichte darüber zu reporten. Das Ziel dieser Standards ist es, zur globalen nachhaltigen Entwicklung beizutragen, indem Unternehmen und andere Organisationen dazu ermutigt werden, gesellschaftliche Verantwortung zu praktizieren.
📌 Good-To-Know: Die ISO 26000 ist der originale international verfasste Leitfaden. Die DIN ISO 26000 ist die identische Norm in deutscher Version, mit derselben fachlichen Substanz.

Was behandelt die ISO 26000?
Die DIN EN ISO 26000 beschreibt sieben Kernthemen mit insgesamt 37 Handlungsfeldern, in denen Unternehmen und andere Organisationen weltweit aktiv sein können und sollten. Alle Bereiche sind relevant, müssen jedoch je nach Branche und unternehmensspezifischen Kriterien unterschiedlich gewichtet werden.
Dies umfasst eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die Transparenz, ethisches Verhalten und Rechenschaftspflicht sicherstellt. Dabei wird die soziale Verantwortung in die gesamte Organisation, einschließlich ihrer Strategie und aller Entscheidungsprozesse, integriert. Die Organisationsführung bildet das Fundament für alle anderen Kernthemen.
- Organisationsführung: Implementierung transparenter, rechenschaftspflichtiger und ethischer Entscheidungsprozesse unter Berücksichtigung der Stakeholder-Erwartungen
Dieses Kernthema umfasst die Achtung und Förderung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Diskriminierung, Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Zudem geht es um den Schutz der Rechte von gefährdeten und marginalisierten Gruppen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der systematischen Prüfung der gesamten Wertschöpfungskette.
- Gebührende Sorgfalt: Proaktive Identifikation und Bewertung potenzieller Menschenrechtsverletzungen in der Wertschöpfungskette
- Kritische Situationen: Besondere Sorgfaltspflicht in Konfliktgebieten oder bei schwacher Governance
- Mittäterschaft vermeiden: Verhinderung direkter oder indirekter Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen
- Missstände beseitigen: Wirksame Beschwerdemechanismen und Abhilfemaßnahmen für Betroffene
- Diskriminierung bekämpfen: Schutz schutzbedürftiger Gruppen und Förderung der Gleichstellung
- Bürgerliche und politische Rechte: Respektierung von Meinungs-, Versammlungs- und Privatsphärenrechten
- Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: Beitrag zu Arbeit, Bildung, Gesundheit und angemessenem Lebensstandard
- Grundlegende Arbeitsrechte: Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und Vereinigungsfreiheit
Es sollen faire Arbeitsbedingungen gefördert werden und die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz muss gewährleistet sein. Dieses Kernthema schließt auch die Anerkennung und Einhaltung von Arbeitsrechten ein. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer sicheren und entwicklungsorientierten Arbeitsumgebung.
- Beschäftigung und Beschäftigungsverhältnisse: Faire, transparente Einstellungspraktiken und stabile Arbeitsverhältnisse
- Arbeitsbedingungen und Sozialschutz: Angemessene Löhne, Arbeitszeiten und Zugang zu sozialen Leistungen
- Sozialer Dialog: Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie Anerkennung von Gewerkschaften
- Gesundheit und Sicherheit: Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung und Prävention von Arbeitsunfällen
- Entwicklung und Schulung: Förderung der beruflichen Entwicklung durch Bildung und Kompetenzentwicklung
Umweltaspekte umfassen alle Bereiche des betrieblichen Umweltschutzes, von der Ressourcenschonung über Emissionsreduktion bis hin zur Kreislaufwirtschaft und dem Schutz der Biodiversität. Organisationen müssen ihre Umweltauswirkungen systematisch bewerten und minimieren.
- Umweltbelastung vermeiden: Reduzierung von Luft-, Wasser- und Bodenverunreinigungen sowie verantwortungsvolle Abfallentsorgung
- Nachhaltige Ressourcennutzung: Effiziente Nutzung von Wasser, Energie und natürlichen Ressourcen sowie Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Klimawandel: Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Anpassung an Klimaauswirkungen
- Biodiversität und Lebensräume: Schutz und Wiederherstellung von Ökosystemen und biologischer Vielfalt
Hierunter fallen ethische Geschäftspraktiken, Anti-Korruption, fairer Wettbewerb und die verantwortungsvolle Gestaltung der Lieferketten sowie der Umgang mit Geschäftspartnern. Transparenz und Integrität stehen im Mittelpunkt aller Geschäftsbeziehungen.
- Korruptionsbekämpfung: Implementierung von Anti-Korruptionsrichtlinien und robusten Kontrollsystemen
- Politische Mitwirkung: Transparente und ethische Beteiligung an politischen Prozessen und Lobbying
- Fairer Wettbewerb: Einhaltung kartellrechtlicher Bestimmungen und Vermeidung wettbewerbswidriger Praktiken
- Verantwortung in der Wertschöpfungskette: Förderung gesellschaftlicher Verantwortung bei Lieferanten und Geschäftspartnern
- Eigentumsrechte: Respektierung von geistigem und physischem Eigentum sowie Verhinderung von Diebstahl und Betrug
Es geht um den Schutz der Verbraucherinteressen, einschließlich der Produktsicherheit, Förderung eines nachhaltigen Konsums sowie Transparenz für die Verbraucher. Informationen über Produkte und Dienstleistungen sollen klar und transparent bereitgestellt werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit Verbraucherdaten ist von zentraler Bedeutung.
- Faire Werbe- und Vertragspraktiken: Ehrliche, genaue Produktinformationen und faire Vertragsbedingungen
- Gesundheit und Sicherheit: Gewährleistung der Produktsicherheit und Minimierung von Gesundheitsrisiken
- Nachhaltiger Konsum: Förderung umweltfreundlicher Produkte und Aufklärung über Umweltauswirkungen
- Kundendienst und Beschwerdemanagement: Wirksame Kundenservice- und Schlichtungsverfahren
- Datenschutz: Schutz und Vertraulichkeit von Kundendaten sowie Einhaltung von Datenschutzgesetzen
- Grundversorgung: Sicherstellung des Zugangs zu grundlegenden Dienstleistungen für alle Bevölkerungsgruppen
- Verbraucherbildung: Beitrag zur Bildung und Sensibilisierung von Verbrauchern für informierte Entscheidungen
Dieser Punkt umfasst den Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinschaften, in denen die Organisation tätig ist. Dies kann beispielsweise die Förderung von Bildung, Kultur und sozialer Integration in der Gemeinschaft sein sowie die Unterstützung von lokalen Initiativen und Gemeinschaftsprojekten. Ein kontinuierlicher Dialog mit lokalen Stakeholdern ist essentiell.
- Einbindung der Gemeinschaft: Aktive Beteiligung an der Gemeindeentwicklung und Dialog mit lokalen Stakeholdern
- Bildung und Kultur: Unterstützung von Bildungseinrichtungen und Erhalt des kulturellen Erbes
- Arbeitsplätze und Qualifizierung: Schaffung lokaler Arbeitsplätze und Förderung beruflicher Entwicklung
- Technologieentwicklung: Förderung des Technologietransfers und der digitalen Inklusion
- Wohlstand und Einkommen: Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung durch lokale Beschaffung und Unternehmensförderung
- Gesundheit: Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten und Reduzierung von Gesundheitsrisiken
- Investition zugunsten des Gemeinwohls: Unterstützung sozialer Infrastruktur und gemeinnütziger Zwecke
📌 Good-To-Know: Die gesellschaftliche Verantwortung ergibt sich aus dem Zusammenspiel zwischen Handlungsfeldern und Anspruchsgruppen. Unternehmen müssen nicht in allen 37 Handlungsfeldern gleichermaßen aktiv sein, sondern sollten ihre Schwerpunkte basierend auf Stakeholder-Erwartungen und Branchenspezifika setzen.
Ziele der ISO 26000
Die ISO 26000 verfolgt mehrere zentrale Ziele, die sich in verschiedene Bereiche gliedern lassen:
- Orientierung und Standardisierung: Der Leitfaden soll Unternehmen helfen, das wertebasierte Handeln und gesellschaftliche Verantwortung strategisch zu planen und umzusetzen. Gleichzeitig dient die Norm dazu, die Aktivitäten zur Corporate Social Responsibility zu standardisieren.
- Universelle Anwendbarkeit: ISO 26000 ist für die Nutzung durch alle Organisationen konzipiert, nicht nur für Unternehmen und Konzerne. Organisationen wie Krankenhäuser und Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen usw. sind ebenfalls eingeschlossen.
- Stakeholder-Integration: Ein wesentliches Ziel ist die systematische Einbindung aller relevanten Anspruchsgruppen in Entscheidungsprozesse und die Berücksichtigung ihrer Interessen und Erwartungen.
Wichtige Eckdaten
Die ISO 26000 wurde im November 2010 veröffentlicht und im Jahr 2021 erneut von der ISO überprüft und bestätigt. Sie bleibt damit weiterhin als aktueller Leitfaden gültig. Da es sich um eine nicht zertifizierbare Leitlinie handelt, ist sie ohne zeitliche Befristung anwendbar, bis sie gegebenenfalls revidiert oder ersetzt wird.
Die Norm richtet sich an alle Arten von Organisationen, unabhängig von ihrer Größe und dem Standort. Von multinationalen Konzernen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen können alle Organisationsformen von der Anwendung profitieren.
ISO 26000 ist ein Leitfaden-Standard und enthält keine Anforderungen wie die, die verwendet werden, wenn ein Standard zur „Zertifizierung“ angeboten wird. Die Anwendung ist vollständig freiwillig und basiert auf Eigeninitiative der Organisationen.
Da es sich um einen freiwilligen Leitfaden handelt, sind keine direkten Strafen mit der Nichtbeachtung der ISO 26000 verbunden. Allerdings können sich indirekte Konsequenzen durch Reputationsschäden oder Ausschluss von bestimmten Geschäftsmöglichkeiten ergeben.
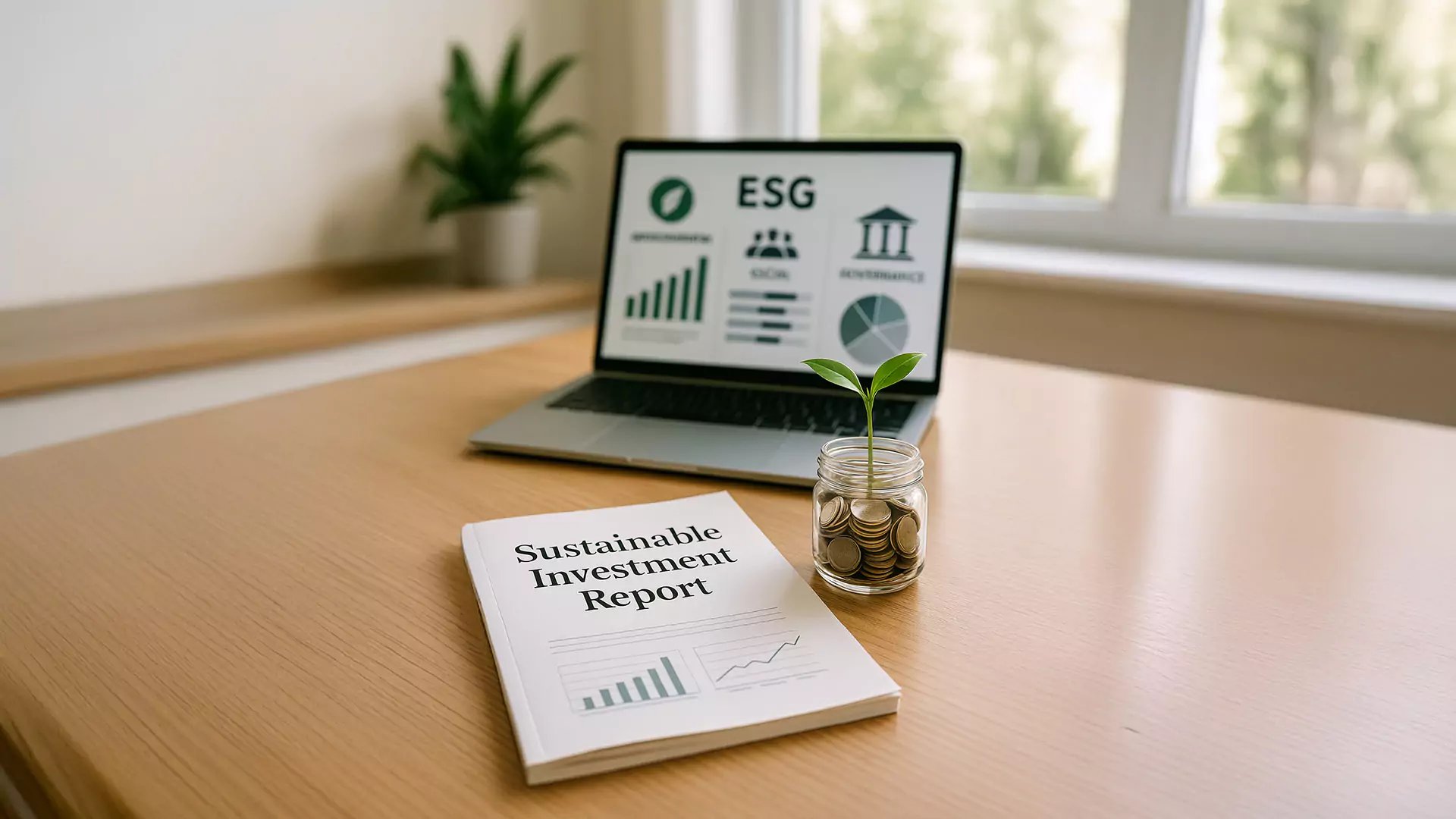
Welche Bedeutung hat die ISO 26000 für nachhaltiges Investieren?
Die ISO 26000 hat für nachhaltiges Investieren eher eine Orientierungsfunktion, da sie zwar den Rahmen für gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften beschreibt, jedoch keine konkreten Vorgaben an Unternehmen stellt.
Dennoch nimmt sie alleine durch ihre Präsenz Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen. Sie definiert sieben Kernhandlungsfelder wie Umwelt, faire Geschäftspraktiken und Menschenrechte, die eng mit den ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) verknüpft sind. Unternehmen, die sich an der ISO 26000 ausrichten, schaffen damit Transparenz über ihre Nachhaltigkeitsstrategien und erhöhen die Glaubwürdigkeit gegenüber Investoren. Für nachhaltige Investments dient der Standard als Referenz, um die Qualität und Ernsthaftigkeit von Nachhaltigkeitsmaßnahmen besser einzuschätzen.
📌 Good-To-Know: Für private Investor:innen ist der Leitfaden nicht direkt anwendbar, da er in erster Linie Organisationen adressiert. Allerdings spielt er häufig als Auswahlkriterium bei nachhaltigen ETFs oder nachhaltigen Fonds eine Rolle. So können auch Sie als private:r Anleger:in indirekt davon profitieren, wenn Sie in solche Finanzprodukte investieren.
Nachhaltig investieren - In Unternehmen mit echtem Impact.
Hier erfahren Sie, wie nachhaltiges Investieren schon mit kleinen Beträgen gelingt. Gemeinsam für doppelte Rendite: Finanziell, wie auch ökologisch.
Welche Herausforderungen gibt es?
Die Anwendung der ISO 26000 ist mit einer gewissen Lernkurve verbunden, da es keine spezifische externe Belohnung, wie eine Zertifizierung, gibt. Die Implementierung der ISO 26000 ist zweifelsohne sehr wertvoll für ein Unternehmen, jedoch ist ihre Umsetzung komplex.
Viele Organisationen haben Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der umfangreichen Handlungsfelder und der systematischen Stakeholder-Einbindung. Dennoch bietet gerade diese Herausforderung Unternehmen die Chance, sich als Vorreiter in Sachen gesellschaftlicher Verantwortung zu positionieren und langfristige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Fazit
Die ISO 26000 erweist sich als unverzichtbarer Kompass für Unternehmen auf dem Weg zu echter gesellschaftlicher Verantwortung und bietet Investor:innen einen verlässlichen Orientierungsrahmen für nachhaltige Investments. Als Grundlage der ESG-Standards kombiniert sie umfassende Themenabdeckung mit praktischer Anwendbarkeit. Für nachhaltigkeitsorientierte Anleger:innen stellt sie ein wertvolles Instrument dar, um Unternehmen mit echtem Nachhaltigkeitsengagement zu identifizieren und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Häufig gestellte Fragen
Kann man sich nach ISO 26000 zertifizieren lassen?
Nein, ISO 26000 wurde nicht mit der Absicht einer Zertifizierung entwickelt. Es handelt sich ausschließlich um einen Leitfaden zur Orientierung.
Wie unterscheidet sich ISO 26000 von anderen ESG-Standards?
Die ISO 26000 ist umfassender angelegt als viele andere Standards und deckt alle Aspekte gesellschaftlicher Verantwortung ab, während andere Standards oft spezifische Bereiche fokussieren. ISO-Standards funktionieren gut mit anderen ESG-Frameworks zusammen.
Welche Rolle spielt ISO 26000 bei der CSRD-Berichterstattung?
Großen Unternehmen ist die Norm eine Hilfe bei der noch jungen CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber auch immer mehr kleinere Unternehmen interessieren sich vermehrt für die Integration einer entsprechenden Strategie. Die ISO 26000 bietet den inhaltlichen Rahmen, während die CSRD die Berichtspflichten definiert.